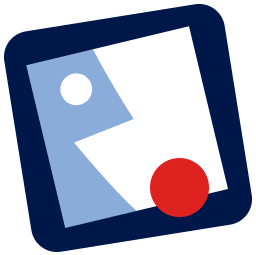Interviews in puncto

Auf dieser Seite finden Sie alle Beiträge aus der Rubrik „Nachgefragt“ unseres Newsletters „in puncto – kulturelle Bildung“
Hinweis: Die Artikel geben die Meinungen der Interviewten wieder und stellen nicht grundsätzlich die Meinung der LKJ Sachsen e.V. dar.
Nachgefragt: Evelyn Iwanow-Heyn, Vorstandsvorsitzende der LKJ Sachsen e.V.
Evelyn Iwanow-Heyn ist seit 30 Jahren Vorstandsvorsitzende der LKJ Sachsen e.V. sowie Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Landesverbandes Tanz (SLVT) und seit kurzem auch 1. Vorsitzende im Vorstand des Deutschen Bundesverbandes Tanz.
Nachgefragt: Meerab Hussain, Festivalteam CREATE.U/ Festival „Betonblühen“
Interview mit Meerab Hussain, Festivalteam CREATE.U/ Festival „Betonblühen“ im Newsletter „in puncto – kulturelle Bildung 03/25
Nachgefragt: Sophie Renz, Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Amateurtheater Sachsen e.V.
Sophie Renz, Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Amateurtheater Sachsen e.V. im Interview. Sie gibt Einblicke in die aktuelle Situation des LATS.
Nachgefragt: Tobias Kämpf, Bürgermeister für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Stadt Plauen
Tobias Kämpf, Bürgermeister der Stadt Plauen im Interview. Er erläutert, wie die Stadt in Sachen kulturelle Bildung aufgestellt ist. Am 6. September 2025 wird hier das 1. Sächsische Kinderkunstfestival stattfinden.
Interview mit Valentin Hacke, pädagogischer Leiter des Kulturbrücken Görlitz e.V.
Wöchentlich nutzen etwa 200 Kinder und Jugendliche die Angebote des Görlitzer Kulturbrücken e.V., der als „CYRKUS“ grenzübergreifende zirkuspädagogische Arbeit macht. Valentin Hacke schildert, wie Finanzierungsunsicherheiten von Land und Landkreis sowie weiteren Förderern den Verein in Schwierigkeiten bringen.
Nachgefragt: Dirk Strobel, künstlerischer Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums Sachsen e.V.
Dirk Strobel, künstlerischer Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums Sachsen e.V. (TPZ Sachsen), bezieht Stellung zu den geplanten Kürzungen im Kommunalhaushalt der Stadt Dresden. Er zeigt die Auswirkungen auf die Arbeit des Vereins auf, welcher seit 2018 Mitglied der LKJ Sachsen ist.