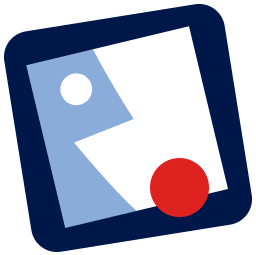Nachgefragt: Petra Köpping, Sächsische Sozialministerin
Wir haben die sächsische Sozialministerin Petra Köpping in ihrer Rolle als derzeitige Sozialministerin und als Spitzenkandidatin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag für das Amt der Ministerpräsidentin befragt.
Frau Köpping, seit 2020 sind Sie Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt – einer Ihrer zahlreichen Bereiche ist die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit – was konnten Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit für Kinder und Jugendliche in Sachsen erreichen und wo sehen Sie Ausbau- und Verbesserungsbedarf?
Jugendarbeit ist mir wichtig! Wir als Sozialministerium (SMS) unterstützen die Landkreise und Kreisfreien Städte bei dieser Aufgabe, unter anderem über die Jugendpauschale mit insgesamt ausgereichten 15 Mio. Euro jährlich. Grundsätzlich gilt, dass Jugendarbeit eine vorrangige Aufgabe der kommunalen Ebene ist und damit auch überwiegend durch Angebote auf örtlicher Ebene umgesetzt wird.
Außerdem fördert mein Haus seit Jahren überörtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe und deren Angebote im Bereich Jugendarbeit und außerschulische Jugendbildung. Im Bereich kulturelle Bildung sind das die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e.V. (LKJ Sachsen) und der Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. Als seit Jahren erfolgreich etablierte Projekte können der Jugendkunstpreis sowie die Nacht der Jugendkulturen benannt werden, die von der LKJ Sachsen umgesetzt werden.
Für die Förderrichtlinie Überörtlicher Bedarf stehen insgesamt in diesem Jahr rund 8 Millionen Euro zur Verfügung.
Projekte zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen im Bereich Jugendarbeit und außerschulische Jugendbildung erhalten ebenfalls eine Förderung. In der Richtlinie Weiterentwicklung stehen in diesem Jahr rund 8 Millionen Euro zur Verfügung. Zu nennen sind hier u.a. Projekte wie die Jugend-App yoggl, die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung, das Flexible Jugendmanagement in den Landkreisen oder der Projektverbund Stark im Land. Die Jugend-App yoggl bietet einen niedrigschwelligen und lebensweltnahen Zugang für junge Menschen zur sächsischen Jugendhilfelandschaft. Darin können beispielsweise Jugendhäuser und Beratungsstellen mit ihren jeweiligen Angeboten gefunden werden. Das Smartphone ist zum wichtigsten Medium junger Menschen geworden. Mit Hilfe der App wird jungen Menschen nun mehr selbstbestimmte Teilhabe ermöglicht. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ich freue mich darüber hinaus sehr, dass mit dem Projekt „C the unseen – Nacht der Jugendkulturen“ im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz eine Verbindung zur Kulturhauptstadt 2025 geschaffen wird.
Mir ist es zudem sehr wichtig, dass sich mein Haus im Bereich der außerschulischen Jugendbildung auch im Themenfeld kulturelle Bildung als Akteur einbringt. Mit der Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) Kulturelle Bildung gibt es daher einen regelmäßigen ressortübergreifenden fachlichen Austausch. In diesem Zusammenhang organisiert mein Haus abwechselnd mit dem Kultusministerium (SMK) und dem Kulturministerium (SMKT) das Ansprechpartnertreffen mit den Kulturräumen und Landesverbänden. Darüber hinaus beteiligt sich mein Haus am Fachbeirat Kulturelle Bildung zur Bewertung von Förderprojekten der Richtlinie des Wissenschaftsministeriums (SMWKT) zur Förderung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen. Zusätzlich beteiligt sich das SMS am Runden Tisch Kulturelle Bildung, als ein Forum für einen landesweiten Dialog und Abstimmungsprozess in diesem Feld.
Eine Erkenntnis der von meinem Haus in Auftrag gegebenen Studie „Wie ticken junge Menschen in Sachsen?“ ist, dass die zukünftige Ausgestaltung von Jugendarbeit und außerschulischer Jugendbildung davon geprägt sein sollte, einerseits das Angebot vor allem im ländlichen Raum auszubauen bzw. überhaupt zu sichern, andererseits aber auch das bestehende Angebot besser auf die Interessen der jungen Menschen auszurichten. Zugleich wird es unsere Aufgabe sein, entsprechend den Ergebnissen des Sechsten Sächsischen Kinder- und Jugendberichtes, der ebenfalls federführend von meinem Haus erarbeitet und kürzlich vorgestellt wurde, den digitalen Transformationsprozess zu begleiten und die sich hieraus bietenden Chancen für Angebote der Jugendarbeit zu nutzen.
Auch die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 zeigt auf, dass junge Menschen im Vergleich zu den Erhebungen der Vorjahre pessimistischer geworden sind und mit der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lage unzufrieden sind. Der Studie entsprechend lässt sich eine Irritation im Vertrauen auf die Zukunftsbewältigung sowie anhaltende Verunsicherung ausmachen. Auffällig sei auch ein hohes Ausmaß von psychischen Belastungen bei jungen Menschen wie Stress und Erschöpfung. Die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024, aber auch der 6. Sächsische Kinder und Jugendbericht verdeutlichen zudem, dass das Smartphone aufgrund einer übermäßigen Nutzung häufig als „Zeitfresser“ empfunden wird und vielfach die Befürchtung vorherrscht, dass soziale Medien negative Auswirkungen auf die eigene Identitätsentwicklung haben. Gleichwohl sehen viele junge Menschen aber auch eine Chance in der Digitalisierung. Gerade weil digitale Medien in der heutigen Zeit einen so großen Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben, braucht es besondere Anstrengungen in diesem Feld. Ich bin daher sehr froh, dass die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen als thematischer Arbeitsschwerpunkt Einzug in die aktuelle überörtliche Jugendhilfeplanung gefunden hat. Zukünftig benötigen wir hier eine bessere Qualifizierung der Fachkräfte auf der einen Seite und eine Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen auf der anderen Seite.
Dieses Jahr wird in Sachsen wieder gewählt, Sie treten als Spitzenkandidatin für Ihre Partei, die SPD, an – was würde sich in Sachsen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an kultureller Bildung ändern, wenn Sie das Amt der Ministerpräsidentin übernehmen?
Ich würde zum Beispiel gern die Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Lernorten weiter stärken. Gerade im Bereich der kulturellen Bildung sind die Möglichkeiten in Sachsen so vielfältig. Wichtig ist mir auch, dass die Träger und Projekte verlässlich finanziert werden. Das gilt sowohl für die großen Städte, in denen wir viele Familien mit wirtschaftlichen Belastungen finden. Aber auch für die ländlichen Räume, in denen das Angebot an kultureller Bildung gestärkt werden muss.
Das Landeskonzept zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung sollten wir fortschreiben und besser umsetzen. Und ein Verständnis von schulischer Bildung entwickeln, das kulturelle Erfahrungen, Fähigkeiten und Talente in ähnlich hohem Maße wertschätzt wie Fähigkeiten im MINT-Bereich.
All das sind nicht nur Themen für eine Ministerpräsidentin oder einen Ministerpräsidenten. Da können auch die zuständigen Ministerien – Kultus, Soziales und Kultur – viel miteinander tun und bewegen. Und es ist auch ein Thema für unsere Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass auch Eltern und Arbeitgeber die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen stärker wertschätzen und fördern.
Vor den Landtagswahlen stehen anti-demokratische Tendenzen in der Diskussion. In Ihrer „Bautzner Rede“ machen Sie deutlich, dass Sie der „stillen Mitte“ Gehör schenken möchten und Ihnen die soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Wie kann es künftig gelingen, mehr politische und gesellschaftliche Teilhabe anzuregen? Wäre z.B. eine Absenkung des Wahlalters denkbar und von Ihnen angestrebt?
Natürlich, die Absenkung des Wahlalters ist eine langjährige Forderung der SPD – und für die Europawahlen ja inzwischen auch umgesetzt. Es wäre eine große Bereicherung für unsere Demokratie und für Jugendliche selbst, wenn das Wahlalter auch auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene auf 14 oder wenigstens 16 Jahre abgesenkt wird. Aber das ist nur ein Baustein. Politische und gesellschaftliche Teilhabe hat auch viel mit sozialer Gerechtigkeit und fairen Chancen zu tun: Wer trotz harter Arbeit finanziell auf keinen grünen Zweig kommt, der hat oft weder Zeit noch Motivation zur gesellschaftlichen Teilhabe. Deshalb sind mir faire Löhne und Tarifbindung so wichtig.
Und ich denke, dass auch in unseren Schulen sehr viel Potenzial für mehr Teilhabe schlummert. Dabei geht es mir nicht um eine Stunde Gemeinschaftskunde mehr oder weniger, sondern um etwas anderes: Die Frage, was und wie in der Schule gelernt wird. Das gemeinsame Arbeiten mit anderen, das Übernehmen von Verantwortung, das Mitgestalten von Prozessen – all das lernt man am besten durch praktisches Tun. Und dafür sollte schon in der Schulzeit mehr Platz sein. Ich würde mich freuen, wenn schulische Leistungen nicht nur aus Klausuren und Kurzkontrollen über gelernten Stoff bestünden. Kinder und Jugendliche sollten auch die Chance haben, mit praktischem Handeln und ehrenamtlichem Engagement ihre Fähigkeiten und Leistungen unter Beweis zu stellen.
Ein Wort will ich zur „stillen Mitte“ aber noch sagen: Man kann und sollte vieles tun, um die politische Teilhabe der Menschen zu stärken. Aber man wird nicht sofort alle Leute dazu bekommen, sich politisch zu engagieren. In der „stillen Mitte“ finden sich viele Menschen, die sich zurückgezogen haben. Denen die gesellschaftliche Debatte zu laut geworden ist, zu schwarz-weiß, zu undifferenziert. Die fragen sich: Können wir nicht Standpunkte vertreten und dem oder der anderen eine Tür offenlassen für ihren Standpunkt, für ihre Meinung, für ihr Argument? Denn darum geht es doch eigentlich in der Demokratie: Die unterschiedlichen Standpunkte auszugleichen, Kompromisse zu finden, oder wie es so schön heißt: Leben und leben lassen. Diesen Stimmen will ich Gehör schenken, denn ihnen geht es darum, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.